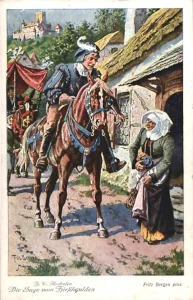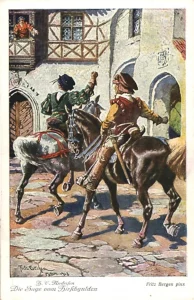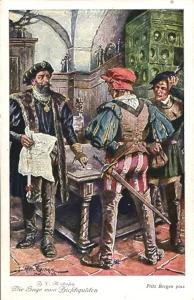Die Sage vom Hirschgulden
Die Sage vom Hirschgulden
aus dem Märchen-Almanach auf das Jahr 1828 von Wilhelm Hauff
In Oberschwaben stehen noch heutzutage die Mauern einer Burg, die einst die stattlichste der Gegend war, Hohenzollern. Sie erhebt sich auf einem runden, steilen Berg, und von ihrer schroffen Höhe sieht man weit und frei ins Land. Soweit und noch viel weiter, als man diese Burg im Lande umher sehen kann, ward das tapfere Geschlechte der Zollern gefürchtet, und ihren Namen kannte und ehrte man in allen deutschen Landen. Nun lebte vor vielen hundert Jahren, ich glaube, das Schießpulver war noch nicht einmal erfunden, auf dieser Feste ein Zollern, der von Natur ein sonderbarer Mensch war. Man konnte nicht sagen, dass er seine Untertanen hart gedrückt oder mit seinen Nachbarn in Fehde gelebt hätte, aber dennoch traute ihm niemand über den Weg, ob seinem finsteren Auge, seiner krausen Stirne und seinem einsilbigen, mürrischen Wesen. Es gab wenige Leute außer dem Schlossgesinde, die ihn je hatten ordentlich sprechen hören wie andere Menschen, denn wenn er durch das Tal ritt, einer ihm begegnete und schnell die Mütze abnahm, sich hinstellte und sagte: „Guten Abend, Herr Graf, heute macht es schön Wetter“, so antwortete er: „Dummes Zeug“, oder „Weiß schon“. Hatte aber einer etwas nicht recht gemacht, für ihn oder seine Rosse, begegnete ihm ein Bauer im Hohlweg mit dem Karren, dass er auf seinem Rappen nicht schnell genug vorüberkommen konnte, so entlud sich sein Ingrimm in einem Donner von Flüchen; doch hat man nie gehört, dass er bei solchen Gelegenheiten einen Bauer geschlagen hätte. In der Gegend aber hieß man ihn „das böse Wetter von Zollern“.
„Das böse Wetter von Zollern“ hatte eine Frau, die der Widerpart von ihm und so mild und freundlich war wie ein Maitag. Oft hat sie Leute, die ihr Eheherr durch harte Reden beleidigt hatte, durch freundliche Worte und ihre gütigen Blicke wieder mit ihm ausgesöhnt; den Armen aber tat sie Gutes, wo sie konnte, und ließ es sich nicht verdrießen, sogar im heißen Sommer oder im schrecklichsten Schneegestöber den steilen Berg herab zu gehen, um arme Leute oder kranke Kinder zu besuchen. Begegnete ihr auf solchen Wegen der Graf, so sagte er mürrisch: „Weiß schon, dummes Zeug“ und ritt weiter.
Manch andere Frau hätte dieses mürrische Wesen abgeschreckt oder eingeschüchtert; die eine hätte gedacht, was gehen mich die armen Leute an, wenn mein Herr sie für dummes Zeug hält; die andere hätte vielleicht aus Stolz oder Unmut die Liebe gegen einen so mürrischen Gemahl erkalten lassen; doch nicht also Frau Hedwig von Zollern. Die liebte ihn nach wie vor, suchte mit ihrer schönen weißen Hand die Falten von seiner braunen Stirne zu streichen, und liebte und ehrte ihn; als aber nach Jahr und Tag der Himmel ein junges Gräflein zum Angebinde bescherte, liebte sie ihren Gatten nicht minder, indem sie ihrem Söhnlein dennoch alle Pflichten einer zärtlichen Mutter erzeigte. Drei Jahre lang vergingen, und der Graf von Zollern sah seinen Sohn nur alle Sonntage nach Tische, wo er ihm von der Amme dargereicht wurde. Er blickte ihn dann unverwandt an, brummte etwas in den Bart und gab ihn der Amme zurück. Als jedoch der Kleine Vater sagen konnte, schenkte der Graf der Amme einen Gulden – dem Kind machte er kein fröhlicher Gesicht.
An seinem dritten Geburtstag aber ließ der Graf seinem Sohn die ersten Höslein anziehen und kleidete ihn prächtig in Samt und Seide; dann befahl er, seinen Rappen und ein anderes schönes Ross vorzuführen, nahm den Kleinen auf den Arm und fing an, mit klirrenden Sporen die Wendeltreppe hinab zu steigen. Frau Hedwig erstaunte, als sie dies sah. Sie war sonst gewohnt, nicht zu fragen, wo aus und wann heim? wenn er ausritt, aber diesmal öffnete die Sorge um ihr Kind ihre Lippen. „Wollet Ihr ausreiten, Herr Graf?“ sprach sie – Er gab keine Antwort, „wozu denn den Kleinen?“ fragte sie weiter; „Kuno wird mit mir spazieren gehen.“
„Weiß schon“, entgegnete das böse Wetter von Zollern und ging weiter; und als er im Hof stand, nahm er den Knaben bei einem Füßlein, hob ihn schnell in den Sattel, band ihn mit einem Tuch fest, schwang sich selbst auf den Rappen und trabte zum Burgtore hinaus, indem er den Zügel vom Rosse seines Söhnleins in die Hand nahm.
Dem Kleinen schien es anfangs großes Vergnügen zu gewähren, mit dem Vater den Berg hinab zu reiten. Er klopfte in die Hände, er lachte und schüttelte sein Rösslein an den Mähnen, damit es schneller laufen sollte, und der Graf hatte seine Freude daran, rief auch einigemal: „Kannst ein wackerer Bursche werden.“
Als sie aber in der Ebene angekommen waren und der Graf statt Schritt Trab anschlug, da vergingen dem Kleinen die Sinne; er bat anfangs ganz bescheiden, sein Vater möchte langsamer reiten, als es aber immer schneller ging, und der heftige Wind dem armen Kuno beinahe den Atem nahm, da fing er an, still zu weinen, wurde immer ungeduldiger und schrie am Ende aus Leibeskräften.
„Weiß schon! dummes Zeug!“ fing jetzt sein Vater an. „Heult der Junge beim ersten Ritt! schweig, oder – – –“ Doch den Augenblick, als er mit einem Fluche sein Söhnlein aufmuntern wollte, bäumte sich sein Ross; der Zügel des andern entfiel seiner Hand, er arbeitet sich ab, Meister seines Tieres zu werden, und als er es zur Ruhe gebracht hatte und sich ängstlich nach seinem Kind umsah, erblickte er dessen Pferd, wie es ledig und ohne den kleinen Reiter der Burg zulief.
So ein harter, finsterer Mann der Graf von Zollern sonst war, so überwand doch dieser Anblick sein Herz; er glaubte nicht anders, als sein Kind liege zerschmettert am Weg, er raufte sich den Bart und jammerte. Aber nirgends, soweit er zurückritt, sah er eine Spur von dem Knaben; schon stellte er sich vor, das scheu gewordene Ross habe ihn in einen Wassergraben geschleudert, der neben dem Wege lag. Da hörte er von einer Kinderstimme hinter sich seinen Namen rufen, und als er sich flugs umwandte – sieh, da saß ein altes Weib unweit der Straße unter einem Baum und wiegte den Kleinen auf ihren Knien.
„Wie kommst du zu dem Knaben, alte Hexe?“ schrie der Graf in großem Zorn; „sogleich bringe ihn heran zu mir!“
„Nicht so rasch, nicht so rasch, Euer Gnaden!“ lachte die alte, hässliche Frau, „könntet sonst auch ein Unglück nehmen auf Eurem stolzen Ross! wie ich zu dem Junkerlein kam, fraget Ihr. Nun, sein Pferd ging durch, und er hing nur noch mit einem Füßchen angebunden und das Haar streifte fast am Boden, da habe ich ihn aufgefangen in meiner Schürze.“
„Weiß schon!“ rief der Herr von Zollern unmutig, „gib ihn jetzt her; ich kann nicht wohl absteigen, das Ross ist wild und könnte ihn schlagen.“
„Schenket mir einen Hirschgulden!“ erwiderte die Frau demütig bittend.
„Dummes Zeug!“ schrie der Graf und warf ihr einige Pfennige unter den Baum.
„Nein! einen Hirschgulden könnte ich gut brauchen“, fuhr sie fort.
„Was Hirschgulden! Bist selbst keinen Hirschgulden wert“, eiferte der Graf, „schnell das Kind her, oder ich hetze die Hunde auf dich!“
„So? Bin ich keinen Hirschgulden wert“, antwortete jene mit höhnischem Lächeln; „na, man wird ja sehen, was von Eurem Erbe einen Hirschgulden wert ist; aber da, die Pfennige behaltet für Euch.“ Indem sie dies sagte, warf sie die drei kleinen Kupferstücke dem Grafen zu, und so gut konnte die Alte werfen, dass alle drei ganz gerade in den kleinen Lederbeutel fielen, den der Graf noch in der Hand hielt.
Der Graf wusste einige Minuten vor Staunen über diese wunderbare Geschicklichkeit kein Wort hervorzubringen, endlich aber löste sich sein Staunen in Wut auf. Er fasste seine Büchse, spannte den Hahn und zielte dann auf die Alte. Diese herzte und küsste ganz ruhig den kleinen Grafen, indem sie ihn so vor sich hin hielt, dass ihn die Kugel zuerst hätte treffen müssen. „Bist ein guter, frommer Junge“, sprach sie, „bleibe nur so, und es wird dir nicht fehlen.“ Dann ließ sie ihn los, drohte dem Grafen mit dem Finger: „Zollern, Zollern, den Hirschgulden bleibt Ihr mir noch schuldig“, rief sie und schlich, unbekümmert um die Schimpfworte des Grafen, an einem Buchsbaumstäbchen in den Wald. Konrad, der Knappe, aber stieg zitternd von seinem Ross, hob das Herrlein in den Sattel, schwang sich hinter ihm auf und ritt seinem Gebieter nach, den Schlossberg hinauf.
Es war dies das erste und letzte Mal gewesen, dass das böse Wetter von Zollern sein Söhnlein mitnahm zum Spazierenreiten; denn er hielt ihn, weil er geweint und geschrien, als die Pferde in Trab gingen, für einen weichlichen Jungen, aus dem nicht viel Gutes zu machen sei, sah ihn nur mit Unlust an, und so oft der Knabe, der seinen Vater herzlich liebte, schmeichelnd und freundlich zu seinen Knien kam, winkte er ihm, fortzugehen und rief: „Weiß schon! Dummes Zeug!“ Frau Hedwig hatte alle bösen Launen ihres Gemahls gerne getragen, aber dieses unfreundliche Benehmen gegen das unschuldige Kind kränkte sie tief; sie erkrankte mehrere Male aus Schrecken, wenn der finstere Graf den Kleinen wegen irgend eines geringen Fehlers hart abgestraft hatte, und starb endlich in ihren besten Jahren, von ihrem Gesinde und der ganzen Umgegend, am schmerzlichsten aber von ihrem Sohn beweint.
Von jetzt an wandte sich der Sinn des Grafen nur noch mehr von dem Kleinen ab; er gab ihn seiner Amme und dem Hauskapellan zur Erziehung und sah nicht viel nach ihm um, besonders, da er bald darauf wieder ein reiches Fräulein heiratete, die ihm nach Jahresfrist Zwillinge, zwei junge Gräflein, schenkte.
Kunos liebster Spaziergang war zu dem alten Weiblein, die ihm einst das Leben gerettet hatte. Sie erzählte ihm immer vieles von seiner verstorbenen Mutter, und wieviel Gutes diese an ihr getan habe. Die Knechte und Mägde warnten ihn oft, er sollte nicht so viel zu der Frau Feldheimerin, so hieß die Alte, gehen, weil sie nichts mehr und nichts weniger als eine Hexe sei, aber der Kleine fürchtete sich nicht, denn der Schlosskaplan hatte ihn gelehrt, dass es keine Hexen gebe, und dass die Sage, dass gewisse Frauen zaubern können und auf der Ofengabel durch die Luft und auf den Brocken reiten, erlogen sei. Zwar sah er bei der Frau Feldheimerin allerlei Dinge, die er nicht begreifen konnte; des Kunststückchens mit den drei Pfennigen, die sie seinem Vater so geschickt in den Beutel geworfen, erinnerte er sich noch ganz wohl, auch konnte sie allerhand künstliche Salben und Tränklein bereiten, womit sie Menschen und Vieh heilte, aber das war nicht wahr, was man ihr nachsagte, dass sie eine Wetterpfanne habe, und wenn sie diese über das Feuer hänge, komme ein schreckliches Donnerwetter. Sie lehrte den kleinen Grafen mancherlei, was ihm nützlich war, zum Beispiel allerlei Mittel für kranke Pferde, einen Trank gegen die Hundswut, eine Lockspeise für Fische und viele andere nützliche Sachen. Die Frau Feldheimerin war auch bald seine einzige Gesellschaft, denn seine Amme starb, und seine Stiefmutter kümmerte sich nicht um ihn.
Als seine Brüder nach und nach heranwuchsen, hatte Kuno ein noch traurigeres Leben als zuvor, sie hatten das Glück, beim ersten Ritt nicht vom Pferd zu stürzen, und das böse Wetter von Zollern hielt sie daher für ganz vernünftige und taugliche Jungen, liebte sie ausschließlich, ritt alle Tag mit ihnen aus und lehrte sie alles, was er selbst verstand. Da lernten sie aber nicht viel Gutes; Lesen und Schreiben konnte er selbst nicht, und seine beiden trefflichen Söhne sollten sich auch nicht die Zeit damit verderben; aber schon in ihrem zehnten Jahr konnten sie so grässlich fluchen als ihr Vater, fingen mit jedem Händel an, vertrugen sich unter sich selbst so schlecht wie ein Hund und Kater, und nur wenn sie gegen Kuno einen Streich verüben wollten, verbanden sie sich und wurden Freunde.
Ihrer Mutter machte dies nicht viel Kummer, denn sie hielt es für gesund und kräftig, wenn sich die Jungen balgten, aber dem alten Grafen sagte es eines Tags ein Diener, und er antwortete zwar: „Weiß schon, dummes Zeug!“ nahm sich aber dennoch vor, für die Zukunft auf ein Mittel zu sinnen, dass sich seine Söhne nicht gegenseitig totschlügen; denn die Drohung der Frau Feldheimerin, die er in seinem Herzen für eine ausgemachte Hexe hielt: „Na, man wird ja sehen, was von Eurem Erbe einen Hirschgulden wert ist“ – lag ihm noch immer in seinem Sinn. Eines Tages, da er in der Umgegend seines Schlosses jagte, fielen ihm zwei Berge ins Auge, die ihrer Form wegen wie zu Schlössern geschaffen schienen, und sogleich beschloss er auch, dort zu bauen. Er baute auf dem einen das Schloss Schalksberg, das er nach dem kleinern der Zwillinge so nannte, weil dieser wegen allerlei böser Streiche längst von ihm den Namen kleiner Schalk erhalten hatte, das andere Schloss, das er baute, wollte er anfänglich Hirschguldenberg nennen, um die Hexe zu verhöhnen, weil sie sein Erbe nicht einmal eines Hirschguldens wert achtete, er ließ es aber bei dem einfacheren Hirschberg bewenden, und so heißen die beiden Berge noch bis auf den heutigen Tag, und wer die Alp bereist, kann sie sich zeigen lassen.
Das böse Wetter von Zollern hatte anfänglich im Sinn, seinem ältesten Sohn Zollern, dem „kleinen Schalk“ Schalksberg und dem andern Hirschberg im Testament zu vermachen; aber seine Frau ruhte nicht eher, bis er es änderte: „der dumme Kuno“, so nannte sie den armen Knaben, weil er nicht so wild und ausgelassen war wie ihre Söhne, „der dumme Kuno ist ohnedies reich genug durch das, was er von seiner Mutter erbte, und er soll auch noch das schöne, reiche Zollern haben? und meine Söhne sollen nichts bekommen, als jeder eine Burg, zu welcher nichts gehört als Wald?“
Vergebens stellte ihr der Graf vor, dass man Kuno billigerweise das Erstgeburtsrecht nicht rauben dürfe, sie weinte und zankte so lange, bis das böse Wetter, das sonst niemandem sich fügte, des lieben Friedens willen nachgab und im Testament dem kleinen Schalk Schalksberg, Wolf, dem größern Zwillingsbruder, Zollern und Kuno Hirschberg mit dem Städtchen Balingen verschrieb. Bald darauf, nachdem er also verfügt hatte, fiel er auch in eine schwere Krankheit. Zu dem Arzt, der ihm sagte, dass er sterben müsse, sagte er, „ich weiß schon“, und dem Schlosskaplan, der ihn ermahnte, sich zu einem frommen Ende vorzubereiten, antwortete er „dummes Zeug“, fluchte und raste fort und starb, wie er gelebt hatte, roh und als ein großer Sünder.
Aber sein Leichnam war noch nicht beigesetzt, so kam die Frau Gräfin schon mit dem Testament herbei, sagte zu Kuno, ihrem Stiefsohn, spöttisch, er möchte jetzt seine Gelehrsamkeit beweisen und selbst nachlesen, was im Testament stehe, nämlich, dass er in Zollern nichts mehr zu tun habe, und freute sich mit ihren Söhnen über das schöne Vermögen und die beiden Schlösser, die sie ihm, dem Erstgebornen, entrissen hatten.
Kuno fügte sich ohne Murren in den Willen des Verstorbenen, aber mit Tränen nahm er Abschied von der Burg, wo er geboren worden, wo seine gute Mutter begraben lag, und wo der gute Schlosskaplan und nahe dabei seine einzige alte Freundin, Frau Feldheimerin, wohnte. Das Schloss Hirschberg war zwar ein schönes, stattliches Gebäude, aber es war ihm doch zu einsam und öde, und er wäre bald krank vor Sehnsucht nach Hohenzollern geworden.
Die Gräfin und die Zwillingsbrüder, die jetzt achtzehn Jahre alt waren, saßen eines Abends auf dem Söller und schauten den Schlossberg hinab; da gewahrten sie einen stattlichen Ritter, der zu Pferde herauf ritt, und dem eine prachtvolle Sänfte, von zwei Maultieren getragen, und mehrere Knechte folgten; sie rieten lange hin und her, wer es wohl sein möchte, da rief endlich der „kleine Schalk“: „Ei, das ist ja niemand anders als unser Herr Bruder von Hirschberg.“
„Der dumme Kuno?“ sprach die Frau Gräfin verwundert; „ei, der wird uns die Ehre antun, uns zu sich einzuladen, und die schöne Sänfte hat er für mich mitgebracht, um mich abzuholen nach Hirschberg; nein, so viel Güte und Lebensart hätte ich meinem Herrn Sohn, dem dummen Kuno, nicht zugetraut; eine Höflichkeit ist der andern wert, lasst uns hinabsteigen an das Schlosstor, ihn zu empfangen; macht auch freundliche Gesichter, vielleicht schenkt er uns in Hirschberg etwas, dir ein Pferd und dir einen Harnisch, und den Schmuck seiner Mutter hätte ich schon lange gerne gehabt.“
„Geschenkt mag ich nichts von dem dummen Kuno“, so antwortete Wolf, „und kein gutes Gesicht mach’ ich ihm auch nicht. Aber unserem seligen Herrn Vater könnte er meinetwegen bald folgen, dann würden wir Hirschberg erben und alles, und Euch, Frau Mutter, wollten wir den Schmuck um billigen Preis ablassen.“
„So, du Range!“ eiferte die Mutter, „abkaufen soll ich euch den Schmuck? Ist das der Dank dafür, dass ich euch Zollern verschafft habe? Kleiner Schalk, nicht wahr, ich soll den Schmuck umsonst haben?“
„Umsonst ist der Tod, Frau Mutter!“ erwiderte der Sohn lachend, „und wenn es wahr ist, dass der Schmuck so viel wert ist als manches Schloss, so werden wir wohl nicht die Toren sein, ihn Euch um den Hals zu hängen. Sobald Kuno die Augen schließt, reiten wir hinunter, teilen ab, und meinen Part an Schmuck verkaufe ich. Gebt Ihr dann mehr als der Jude, Frau Mutter, so sollt Ihr ihn haben.“
Sie waren unter diesem Gespräch bis unter das Schlosstor gekommen, und mit Mühe zwang sich die Frau Gräfin, ihren Grimm über den Schmuck zu unterdrücken; denn soeben ritt Graf Kuno über die Zugbrücke. Als er seine Stiefmutter und seine Brüder ansichtig wurde, hielt er sein Pferd an, stieg ab und grüßte sie höflich. Denn obgleich sie ihm viel Leids angetan, bedachte er doch, dass es seine Brüder seien, und dass diese böse Frau sein Vater geliebt hatte.
„Ei, das ist ja schön, dass der Herr Sohn uns auch besucht“, sagte die Frau Gräfin mit süßer Stimme und huldreichem Lächeln. „Wie geht es denn auf Hirschberg? Kann man sich dort angewöhnen? Und gar eine Sänfte hat man sich angeschafft? Ei, und wie prächtig, es dürfte sich keine Kaiserin daran schämen; nun wird wohl auch die Hausfrau nicht mehr lange fehlen, dass sie darin im Lande umherreist.“
„Habe bis jetzt noch nicht daran gedacht, gnädige Frau Mutter“, erwiderte Kuno, „will mir deswegen andere Gesellschaft zur Unterhaltung ins Haus nehmen und bin deswegen mit der Sänfte hierher gereist.“
„Ei, Ihr seid gar gütig und besorgt“, unterbrach ihn die Dame, indem sie sich verneigte und lächelte.
„Denn er kommt doch nicht mehr gut zu Pferde fort“, sprach Kuno ganz ruhig weiter – „der Vater Joseph nämlich, der Schlosskaplan. Ich will ihn zu mir nehmen, er ist mein alter Lehrer, und wir haben es so abgemacht, als ich Zollern verließ. Will auch unten am Berg die alte Frau Feldheimerin mitnehmen. Lieber Gott! sie ist jetzt steinalt und hat mir einst das Leben gerettet, als ich zum erstenmal ausritt mit meinem seligen Vater; habe ja Zimmer genug in Hirschberg, und dort soll sie absterben.“ Er sprach es und ging durch den Hof, um den Pater Schlosskaplan zu holen.
Aber der Junker Wolf biss vor Grimm die Lippen zusammen, die Frau Gräfin wurde gelb vor Ärger, und der „kleine Schalk“ lachte laut auf: „Was gebt ihr mir für meinen Gaul, den ich von ihm geschenkt kriege?“ sagte er; „Bruder Wolf, gib mir deinen Harnisch, den er dir gegeben, dafür! Ha! ha! ha! den Pater und die alte Hexe will er zu sich nehmen? Das ist ein schönes Paar; da kann er nun vormittags Griechisch lernen beim Kaplan und nachmittags Unterricht im Hexen nehmen bei der Frau Feldheimerin. Ei, was macht doch der dumme Kuno für Streiche!“
„Er ist ein ganz gemeiner Mensch!“ erwiderte die Frau Gräfin, „und du solltest nicht darüber lachen, kleiner Schalk; das ist eine Schande für die ganze Familie, und man muss sich ja schämen vor der ganzen Umgegend, wenn es heißt, der Graf von Zollern hat die alte Hexe, die Feldheimerin, abgeholt in einer prachtvollen Sänfte und Maulesel dabei, und lässt sie bei sich wohnen. Das hat er von seiner Mutter; die war auch immer so gemein mit Kranken und schlechtem Gesindel; ach, sein Vater würde sich im Sarg wenden, wüsste er es.“
„Ja“, setzte der kleine Schalk hinzu, „der Vater würde noch in der Gruft sagen: ‚Weiß schon, dummes Zeug.‘“
„Wahrhaftig! da kommt er mit dem alten Mann und schämt sich nicht, ihn selbst unter dem Arm zu führen“, rief die Frau Gräfin mit Entsetzen, „kommt, ich will ihm nicht mehr begegnen.“
Sie entfernten sich, und Kuno geleitete seinen alten Lehrer bis an die Brücke und half ihm selbst in die Sänfte; unten aber am Berg hielt er vor der Hütte der Frau Feldheimerin und fand sie schon fertig, mit einem Bündel voll Gläschen und Töpfchen und Tränklein und anderem Geräte nebst ihrem Buchsbaumstöcklein, einzusteigen.
Es kam übrigens nicht also, wie die Frau Gräfin von Zollern in ihrem bösen Sinn hatte voraussehen wollen. In der ganzen Umgegend wunderte man sich nicht über Ritter Kuno; man fand es schön und löblich, dass er die letzten Tage der alten Frau Feldheimerin aufheitern wollte, man pries ihn als einen frommen Herrn, weil er den alten Pater Joseph in sein Schloss aufgenommen hatte. Die einzigen, die ihm gram waren und auf ihn schmähten, waren seine Brüder und die Gräfin; aber nur zu ihrem eigenen Schaden, denn man nahm allgemein ein Ärgernis an so unnatürlichen Brüdern, und zur Wiedervergeltung ging die Sage, dass sie mit ihrer Mutter schlecht und in beständigem Hader leben und unter sich selbst sich alles mögliche zuleide tun. Graf Kuno von Zollern-Hirschberg machte mehrere Versuche, seine Brüder mit sich auszusöhnen, denn es war ihm unerträglich, wenn sie oft an seiner Feste vorbeiritten, aber nie einsprachen, wenn sie ihm in Wald und Feld begegneten, und ihn kälter begrüßten als einen Landfremden. Aber seine Versuche schlugen meistens fehl, und er wurde noch überdies von ihnen verhöhnt. Eines Tages fiel ihm noch ein Mittel ein, wie er vielleicht ihre Herzen gewinnen könnte, denn er wusste, sie waren geizig und habgierig. Es lag ein Teich zwischen den drei Schlössern beinahe in der Mitte, jedoch so, dass er noch in Kunos Revier gehörte. In diesem Teich befanden sich aber die besten Hechte und Karpfen der ganzen Umgegend, und es war für die Brüder, die gerne fischten, ein nicht geringer Verdruss, dass ihr Vater vergessen hatte, den Teich auf ihr Teil zu schreiben. Sie waren zu stolz, um ohne Vorwissen ihres Bruders dort zu fischen, und doch mochten sie ihm auch kein gutes Wort geben, dass er es ihnen erlauben möchte. Nun kannte er aber seine Brüder, dass ihnen der Teich am Herzen liege, er lud sie daher eines Tages ein, mit ihm dort zusammen zu kommen.
Es war ein schöner Frühlingsmorgen, als beinahe in demselben Augenblick die drei Brüder von drei Burgen dort zusammenkamen. „Ei! sieh da“, rief der kleine Schalk, „das trifft sich ordentlich! ich bin mit Schlag sieben Uhr in Schalksberg weggeritten.“
„Ich auch – und ich“, antworteten die Brüder vom Hirschberg und von Zollern.
„Nun, da muss der Teich hier gerade in der Mitte liegen“, fuhr der Kleine fort. „Es ist ein schönes Wasser.“
„Ja, und eben darum habe ich euch hierher beschieden. Ich weiß, ihr seid beide große Freunde vom Fischen, und ob ich gleich auch zuweilen gerne die Angel auswerfe, so hat doch der Weiher Fische genug für drei Schlösser, und an seinen Ufern ist Platz genug für unserer drei, selbst wenn wir alle auf einmal zu angeln kämen; darum will ich von heute an, dass dieses Wasser Gemeingut für uns sei, und jeder von euch soll gleiche Rechte daran haben wie ich.“
„Ei, der Herr Bruder ist ja gewaltig gnädig gesinnt“, sprach der kleine Schalk mit höhnischem Lächeln, „gibt uns wahrhaftig sechs Morgen Wasser und ein paar hundert Fischlein! Nu – und was werden wir dagegen geben müssen, denn umsonst ist der Tod!“
„Umsonst sollt ihr ihn haben“, sagte Kuno gerührt, „ach! ich möchte euch ja nur zuweilen an diesem Teich sehen und sprechen; sind wir doch eines Vaters Söhne.“
„Nein!“ erwiderte der vom Schalksberg, „das ginge schon nicht, denn es ist nichts Einfältigeres, als in Gesellschaft zu fischen, es verjagt immer einer dem andern die Fische; wollen wir aber Tage ausmachen, etwa Montag und Donnerstag du, Kuno, Dienstag und Freitag Wolf, Mittwoch und Sonnabend ich – so ist es mir ganz recht.“
„Mir nicht einmal dann“, rief der finstere Wolf. „Geschenkt will ich nichts haben und will auch mit niemand teilen; du hast recht, Kuno, dass du uns den Weiher anbietest, denn wir haben eigentlich alle drei gleichen Anteil daran, aber lasst uns darum würfeln, wer ihn in Zukunft besitzen soll; werde ich glücklicher sein als ihr, so könnt ihr immer bei mir anfragen, ob ihr fischen dürft.“
„Ich würfle nie“, entgegnete Kuno, traurig über die Verstocktheit seiner Brüder.
„Ja, freilich“, lachte der kleine Schalk, „er ist ja gar fromm und gottesfürchtig, der Herr Bruder, und hält das Würfelspiel für eine Todsünde; aber ich will euch was anderes vorschlagen, woran sich der frömmste Klausner nicht schämen dürfte. Wir wollen uns Angelschnüre und Haken holen, und wer diesen Morgen, bis die Glocke in Zollern zwölf Uhr schlägt, die meisten Fische angelt, soll den Weiher eigen haben.“
„Ich bin eigentlich ein Tor“, sagte Kuno, „um das noch zu kämpfen, was mir mit Recht als Erbe zugehört; aber damit ihr seht, dass es mir mit der Teilung Ernst war, will ich mein Fischgeräte holen.“
Sie ritten heim, jeder nach seinem Schloss; die Zwillinge schickten in aller Eile ihre Diener aus, ließen alle alten Steine aufheben, um Würmer zur Lockspeise für die Fische im Teich zu finden, Kuno aber nahm sein gewöhnliches Angelzeug und die Speise, die ihn einst Frau Feldheimerin zubereiten gelehrt, und war der erste, der wieder auf dem Platz erschien. Er ließ, als die beiden Zwillinge kamen, diese die besten und bequemsten Stellen auserwählen und warf dann selbst seine Angel aus. Da war es, als ob die Fische in ihm den Herrn dieses Teiches erkannt hätten; ganze Züge von Karpfen und Hechten zogen heran und wimmelten um seine Angel; die ältesten und größten drängten die kleinen weg, jeden Augenblick zog er einen heraus, und wenn er die Angel wieder ins Wasser warf, sperrten schon zwanzig, dreißig die Mäuler auf, um an den spitzigen Haken anzubeißen. Es hatte noch nicht zwei Stunden gedauert, so lag der Boden um ihn her voll der schönsten Fische; da hörte er auf zu fischen und ging zu seinen Brüdern, um zu sehen, was für Geschäfte sie machten. Der kleine Schalk hatte einen kleinen Karpfen und zwei elende Weißfische, Wolf drei Barben und zwei kleine Gründlinge, und beide schauten trübselig in den Teich, denn sie konnten die ungeheure Menge, die Kuno gefangen, gar wohl von ihrem Platz aus bemerken. Als Kuno an seinen Bruder Wolf herankam, sprang dieser halbwütend auf, zerriss die Angelschnur, brach die Rute in Stücke und warf sie in den Teich; „ich wollte, es wären tausend Haken, die ich hineinwerfe, statt dem einen, und an jedem müsste eine von diesen Kreaturen zappeln“, rief er, „aber mit rechten Dingen geht es nimmer zu, es ist ein Zauberspiel und Hexenwerk, wie solltest du denn, dummer Kuno, mehr Fische fangen in einer Stunde, als ich in einem Jahr?“
„Ja, ja, jetzt erinnere ich mich“, fuhr der kleine Schalk fort, „bei der Frau Feldheimerin, bei der schnöden Hexe, hat er das Fischen gelernt, und wir waren Toren, mit ihm zu fischen, er wird doch bald Hexenmeister werden.“
„Ihr schlechten Menschen!“ entgegnete Kuno unmutig. „Diesen Morgen habe ich hinlänglich Zeit gehabt, euren Geiz, eure Unverschämtheit und eure Rohheit einzusehen. Geht jetzt und kommt nie wieder hierher, und glaubt mir, es wäre für eure Seelen besser, wenn ihr nur halb so fromm und gut wäret als jene Frau, die ihr eine Hexe scheltet.“
„Nein, eine eigentliche Hexe ist sie nicht!“ sagte der Schalk spöttisch lachend. „Solche Weiber können wahrsagen, aber Frau Feldheimerin ist so wenig eine Wahrsagerin, als eine Gans ein Schwan werden kann; hat sie doch dem Vater gesagt: Von seinem Erbe werde man einen guten Teil um einen Hirschgulden kaufen können, das heißt, er werde ganz verlumpen, und doch hat bei seinem Tod alles sein gehört, soweit man von der Zinne von Zollern sehen kann! Geh, geh, Frau Feldheimerin ist nichts als ein törichtes altes Weib, und du – der dumme Kuno.“
Nach diesen Worten entfernte sich der Kleine eilig, denn er fürchtete den starken Arm seines Bruders, und Wolf folgte ihm, indem er alle Flüche hersagte, die er von seinem Vater gelernt hatte.
In tiefster Seele betrübt ging Kuno nach Hause, denn er sah jetzt deutlich, dass seine Brüder nie mehr mit ihm sich vertragen wollten. Er nahm sich auch ihre harten Worte so sehr zu Herzen, dass er des andern Tages sehr krank wurde, und nur der Trost des würdigen Pater Joseph und die kräftigen Tränklein der Frau Feldheimerin retteten ihn vom Tode.
Als aber seine Brüder erfuhren, dass ihr Bruder Kuno schwer darnieder liege, hielten sie ein fröhliches Bankett, und im Weinmut sagten sie sich zu, wenn der dumme Kuno sterbe, so solle der, welcher es zuerst erfahre, alle Kanonen lösen, um es dem andern anzuzeigen, und wer zuerst kanoniere, solle das beste Fass Wein aus Kunos Keller vorwegnehmen dürfen. Wolf ließ nun von da an immer einen Diener in der Nähe von Hirschberg Wache halten, und der kleine Schalk bestach sogar einen Diener Kunos mit vielem Geld, damit er es ihm schnell anzeige, wenn sein Herr in den letzten Zügen liege.
Dieser Knecht aber war seinem milden und frommen Herrn mehr zugetan als dem bösen Grafen von Schalksberg; er fragte also eines Abends Frau Feldheimerin teilnehmend nach dem Befinden seines Herrn, und als diese sagte, dass es ganz gut mit ihm stehe, erzählte er ihr den Anschlag der beiden Brüder und dass sie Freudenschüsse tun wollen auf des Grafen Kunos Tod. Darüber ergrimmte die Alte sehr; sie erzählte es flugs wieder dem Grafen, und als dieser an eine so große Lieblosigkeit seiner Brüder nicht glauben wollte, so riet sie ihm, er solle die Probe machen und aussprengen lassen, er sei tot, so werde man bald hören, ob sie kanonieren, ob nicht. Der Graf ließ den Diener, den sein Bruder bestochen, vor sich kommen, befragte ihn nochmals und befahl ihm, nach Schalksberg zu reiten und sein nahes Ende zu verkünden.
Als nun der Knecht eilends den Hirschberg herabritt, sah ihn der Diener des Grafen Wolf von Zollern, hielt ihn an und fragte, wohin er so eilends zu reiten willens sei. „Ach“, sagte dieser, „mein armer Herr wird diesen Abend nicht überleben, sie haben ihn alle aufgegeben.“
„So? ist’s um diese Zeit?“ rief jener, lief nach seinem Pferd, schwang sich auf und jagte so eilends nach Zollern und den Schlossberg hinan, dass sein Pferd am Tor niederfiel, und er selbst nur noch „Graf Kuno stirbt“ rufen konnte, ehe er ohnmächtig wurde. Da donnerten die Kanonen von Hohenzollern herab, Graf Wolf freute sich mit seiner Mutter über das gute Fass Wein und das Erbe, den Teich, über den Schmuck und den starken Widerhall, den seine Kanonen gaben. Aber was er für Widerhall gehalten, waren die Kanonen von Schalksberg, und Wolf sagte lächelnd zu seiner Mutter: „So hat der Kleine auch einen Spion gehabt, und wir müssen auch den Wein gleich teilen wie das übrige Erbe.“ Dann aber saß er zu Pferd, denn er argwohnte, der kleine Schalk möchte ihm zuvorkommen und vielleicht einige Kostbarkeiten des Verstorbenen wegnehmen, ehe er käme.
Aber am Fischteich begegneten sich die beiden Brüder und jeder errötete vor dem andern, weil beide zuerst nach Hirschberg hatten kommen wollen. Von Kuno sprachen sie kein Wort, als sie zusammen ihren Weg fortsetzten, sondern sie berieten sich brüderlich, wie man es in Zukunft halten wolle, und wem Hirschberg gehören solle. Wie sie aber über die Zugbrücke und in den Schlosshof ritten, da schaute ihr Bruder wohlbehalten und gesund zum Fenster heraus, aber Zorn und Unmut sprühten aus seinen Blicken. Die Brüder erschraken sehr, als sie ihn sahen, hielten ihn anfänglich für ein Gespenst und bekreuzten sich, als sie aber sahen, dass er noch Fleisch und Blut habe, rief Wolf: „Ei, so wollt’ ich doch! Dummes Zeug, ich glaubte, du wärest gestorben.“
„Nun, aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, sagte der Kleine, der mit giftigen Blicken nach seinem Bruder hinaufschaute.
Dieser aber sprach mit donnernder Stimme: „Von dieser Stunde an sind alle Bande der Verwandtschaft zwischen uns los und ledig. Ich habe eure Freudenschüsse wohl vernommen, aber seht zu, auch ich habe fünf Feldschlangen hier auf dem Hof stehen, und habe sie euch zu Ehren scharf laden lassen. Macht, dass ihr aus dem Bereich meiner Kugeln kommt, oder ihr sollt erfahren, wie man auf Hirschberg schießt.“ Sie ließen es sich nicht zweimal sagen, denn sie sahen ihm an, wie Ernst es ihm war; sie gaben also ihren Pferden die Sporen und hielten einen Wettlauf den Berg hinunter, und ihr Bruder schoss eine Stückkugel hinter ihnen her, die über ihren Köpfen wegsauste, dass sie beide zugleich eine tiefe und höfliche Verbeugung machten; er wollte sie aber nur schrecken und nicht verwunden. „Warum hast du denn geschossen?“ fragte der kleine Schalk unmutig; „du Tor, ich schoss nur, weil ich dich hörte.“
„Im Gegenteil, frag’ nur die Mutter!“ erwiderte Wolf, „du warst es, der zuerst schoss, und du hast diese Schande über uns gebracht, kleiner Dachs.“
Der Kleine blieb ihm keinen Ehrentitel schuldig, und als sie am Fischteich angekommen waren, gaben sie sich gegenseitig noch die vom alten Wetter von Zollern geerbten Flüche zum besten und trennten sich in Hass und Unlust.
Tags darauf aber machte Kuno sein Testament, und Frau Feldheimerin sagte zum Pater: „Ich wollte was wetten, er hat keinen guten Brief für die Kanoniere geschrieben.“ Aber so neugierig sie war, und so oft sie in ihren Liebling drang, er sagte ihr nicht, was im Testament stehe, und sie erfuhr es auch nimmer; denn ein Jahr nachher verschied die gute Frau, und ihre Salben und Tränklein halfen ihr nichts, denn sie starb an keiner Krankheit, sondern am achtundneunzigsten Jahr, das auch einen ganz gesunden Menschen endlich unter den Boden bringen kann. Graf Kuno ließ sie bestatten, als ob sie nicht eine arme Frau, sondern seine Mutter gewesen wäre, und es kam ihm nachher noch viel einsamer vor auf seinem Schloss, besonders da der Pater Joseph der Frau Feldheimerin bald folgte.
Doch diese Einsamkeit fühlte er nicht sehr lange; der gute Kuno starb schon in seinem achtundzwanzigsten Jahr, und böse Leute behaupteten an Gift, das ihm der kleine Schalk beigebracht hatte.
Wie dem aber auch sei, einige Stunden nach seinem Tod vernahm man wieder den Donner der Kanonen, und in Zollern und Schalksberg tat man fünfundzwanzig Schüsse. „Diesmal hat er doch daran glauben müssen“, sagte der Schalk, als sie unterwegs zusammentrafen.
„Ja“, antwortete Wolf, „und wenn er noch einmal aufersteht und zum Fenster herausschimpft wie damals, so hab’ ich eine Büchse bei mir, die ihn höflich und stumm machen soll.“
Als sie den Schlossberg hinan ritten, gesellte sich ein Reiter mit Gefolge zu ihnen, den sie nicht kannten. Sie glaubten, es sei vielleicht ein Freund ihres Bruders und komme, um ihn beisetzen zu helfen. Daher gebärdeten sie sich kläglich, priesen vor ihm den Verstorbenen, beklagten sein frühes Hinscheiden, und der kleine Schalk presste sich sogar einige Krokodilstränen aus. Der Ritter antwortete ihnen aber nicht, sondern ritt still und stumm an ihrer Seite den Hirschberg hinauf. „So, jetzt wollen wir es uns bequem machen, und Wein herbei, Kellermeister, vom besten!“ rief Wolf, als er abstieg. Sie gingen die Wendeltreppen hinauf und in den Saal, auch dahin folgte ihnen der stumme Reiter, und als sich die Zwillinge ganz breit an den Tisch gesetzt hatten, zog jener ein Silberstück aus dem Wams, warf es auf den Schiefertisch, dass es umherrollte und klingelte, und sprach: „So, und da habt ihr jetzt euer Erbe, und es wird just recht sein, ein Hirschgulden.“ Da sahen sich die beiden Brüder verwundert an, lachten und fragten ihn, was er damit sagen wolle.
Der Ritter aber zog ein Pergament hervor mit hinlänglichen Siegeln, darin hatte der dumme Kuno alle Feindseligkeiten aufgezeichnet, die ihm die Brüder bei seinen Lebzeiten bewiesen, und am Ende hatte er verordnet und bekannt, dass sein ganzes Erbe, Hab und Gut, außer dem Schmuck seiner seligen Frau Mutter, auf den Fall seines Todes an Württemberg verkauft sei, und zwar – um einen elenden Hirschgulden! Um den Schmuck aber solle man in der Stadt Balingen ein Armenhaus erbauen.
Da erstaunten nun die Brüder abermals, lachten aber nicht dazu, sondern bissen die Zähne zusammen; denn sie konnten gegen Württemberg nichts ausrichten, und so hatten sie das schöne Gut, Wald, Feld, die Stadt Balingen und selbst – den Fischteich verloren und nichts geerbt als einen schlechten Hirschgulden. Den steckte Wolf trotzig in sein Wams, sagte nicht ja und nicht nein, warf sein Barett auf den Kopf und ging trotzig und ohne Gruß an dem württembergischen Kommissär vorbei, schwang sich auf sein Ross und ritt nach Zollern.
Als ihn aber den andern Morgen seine Mutter mit Vorwürfen plagte, dass sie Gut und Schmuck verscherzt haben, ritt er hinüber zum Schalk auf der Schalksburg: „Wollen wir unser Erbe verspielen oder vertrinken?“ fragte er ihn.
„Vertrinken ist besser“, sagte der Schalk, „dann haben beide gewonnen. Wir wollen nach Balingen reiten und uns den Leuten zum Trotz dort sehen lassen, wenn wir auch gleich das Städtlein schmählich verloren.“
„Und im Lamm schenkt man Roten, der Kaiser trinkt ihn nicht besser“, setzte Wolf hinzu.
So ritten sie miteinander nach Balingen ins Lamm und fragten, was die Maß Roter koste, und tranken sich zu, bis der Hirschgulden voll war. Dann stand Wolf auf, zog das Silberstück mit dem springenden Hirsch aus dem Wams, warf ihn auf den Tisch und sprach: „Da habt Ihr Euern Gulden, so wird’s richtig sein.“
Der Wirt aber nahm den Gulden, besah ihn links, besah ihn rechts und sagte lächelnd: „Ja, wenn es kein Hirschgulden wär’, aber gestern nacht kam der Bote von Stuttgart, und heute früh hat man es ausgetrommelt im Namen des Grafen von Württemberg, dem jetzt das Städtlein eigen; die sind abgeschätzt, und gebt mir nur anderes Geld!“
Da sahen sich die beiden Brüder erbleichend an: „Zahl aus!“ sagte der eine. „Hast du keine Münze?“ sagte der andere, und kurz, sie mussten den Gulden schuldig bleiben im Lamm in Balingen. Sie zogen schweigend und nachdenkend ihren Weg, als sie aber an den Kreuzweg kamen, wo es rechts nach Zollern und links nach Schalksberg ging, da sagte der Schalk: „Wie nun? Jetzt haben wir sogar weniger geerbt als gar nichts, und der Wein war überdies schlecht.“
„Jawohl“, erwiderte sein Bruder. „Aber was die Feldheimerin sagte, ist doch eingetroffen: ‚Seht zu, wie viel von seinem Erbe übrigbleiben wird, um einen Hirschgulden!‘ Jetzt haben wir nicht einmal ein Maß Wein dafür kaufen können.“
„Weiß schon!“ antwortete der von der Schalksburg.
„Dummes Zeug!“ sagte der von Zollern und ritt, zerfallen mit sich und der Welt, seinem Schloss zu. –
„Das ist die Sage von dem Hirschgulden“, endete der Zirkelschmidt, „und wahr soll sie sein. Der Wirt in Dürrwangen, das nicht weit von den drei Schlössern liegt, hat sie meinem guten Freund erzählt, der oft als Wegweiser über die Schwäbische Alp ging und immer in Dürrwangen einkehrte.“
(Ab hier geht es bei Hauff mit der „Rahmengeschichte“ weiter: )
Die Gäste gaben dem Zirkelschmidt Beifall. „Was man doch nicht alles hört in der Welt“, rief der Fuhrmann; „wahrhaftig, jetzt erst freut es mich, dass wir die Zeit nicht mit Kartenspielen verderbten, so ist es wahrlich besser; und gemerkt habe ich mir die Geschichte, dass ich sie morgen meinen Kameraden erzählen kann, ohne ein Wort zu fehlen.“
„Mir fiel da, während Ihr so erzähltet, etwas ein“, sagte der Student.
„O erzählet, erzählet!“ baten der Zirkelschmidt und Felix.
„Gut“, antwortete jener, „ob die Reihe jetzt an mich kömmt oder später, ist gleichviel; ich muss da doch heimgeben, was ich gehört. Das, was ich erzählen will, soll sich wirklich einmal begeben haben.“
Er setzt’ sich zurecht und wollt’ eben anheben zu erzählen, als die Wirtin den Spinnrocken beiseite setzte und zu den Gästen an den Tisch trat. „Jetzt, ihr Herren, ist es Zeit, zu Bette zu gehen“, sagte sie; „es hat neun Uhr geschlagen, und morgen ist auch ein Tag.“
„Ei, so gehe zu Bette“, rief der Student, „setze noch eine Flasche Wein für uns hierher, und dann wollen wir dich nicht länger abhalten.“
„Mit nichten“, entgegnete sie grämlich, „solange noch Gäste in der Wirtsstube sitzen, kann Wirtin und Dienstboten nicht weggehen. Und kurz und gut, ihr Herren, macht, dass ihr auf eure Kammern kommt; mir wird die Zeit lang, und länger als neun Uhr darf in meinem Hause nicht gezecht werden.“
„Was fällt Euch ein, Frau Wirtin“, sprach der Zirkelschmidt staunend; „was schadet es denn Euch, ob wir hier sitzen, wenn Ihr auch schon längst schlaft; wir sind rechtliche Leute und werden Euch nichts hinwegtragen, noch ohne Bezahlung fortgehen. Aber so lasse ich mir in keinem Wirtshaus ausbieten.“
Die Frau rollte zornig die Augen: „Meint Ihr, ich werde wegen jedem Lumpen von Handwerksburschen, wegen jedem Straßenläufer, der mir zwölf Kreuzer zu verdienen gibt, meine Hausordnung ändern? Ich sag’ Euch jetzt zum letzten Mal, dass ich den Unfug nicht leide!“
Noch einmal wollte der Zirkelschmidt etwas entgegnen, aber der Student sah ihn bedeutend an und winkte mit den Augen den übrigen. „Gut“, sprach er, „wenn es denn die Frau Wirtin nicht haben will, so lasst uns auf unsere Kammern gehen. Aber Lichter möchten wir gerne haben, um den Weg zu finden.“
„Damit kann ich nicht dienen“, entgegnete sie finster, „die andern werden schon den Weg im Dunkeln finden, und für Euch ist dies Stümpfchen hier hinlänglich; mehr habe ich nicht im Hause.“
Schweigend nahm der junge Herr das Licht und stand auf. Die andern folgten ihm, und die Handwerksbursche nahmen ihre Bündel, um sie in der Kammer bei sich niederzulegen. Sie gingen dem Studenten nach, der ihnen die Treppe hinan leuchtete.
Als sie oben angekommen waren, bat sie der Student, leise aufzutreten, schloss sein Zimmer auf und winkte ihnen herein. „Jetzt ist kein Zweifel mehr“, sagte er, „sie will uns verraten; habt ihr nicht bemerkt, wie ängstlich sie uns zu Bette zu bringen suchte, wie sie uns alle Mittel abschnitt, wach und beisammen zu bleiben. Sie meint wahrscheinlich, wir werden uns jetzt niederlegen, und dann werde sie um so leichteres Spiel haben.“
„Aber meint Ihr nicht, wir könnten noch entkommen?“ fragte Felix; „im Wald kann man doch eher auf Rettung denken als hier im Zimmer.“
„Die Fenster sind auch hier vergittert“, rief der Student, indem er vergebens versuchte, einen der Eisenstäbe des Gitters los zu machen. „Uns bleibt nur ein Ausweg, wenn wir entweichen wollen, durch die Haustüre; aber ich glaube nicht, dass sie uns fortlassen werden.“
„Es käme auf den Versuch an“, sprach der Fuhrmann: „ich will einmal probieren, ob ich bis in den Hof kommen kann. Ist dies möglich, so kehre ich zurück und hole euch nach.“ Die übrigen billigten diesen Vorschlag, der Fuhrmann legte die Schuhe ab und schlich auf den Zehen nach der Treppe; ängstlich lauschten seine Genossen oben im Zimmer; schon war er die eine Hälfte der Treppe glücklich und unbemerkt hinabgestiegen; aber als er sich dort um einen Pfeiler wandte, richtete sich plötzlich eine ungeheure Dogge vor ihm in die Höhe, legte ihre Tatzen auf seine Schultern und wies ihm, gerade seinem Gesicht gegenüber, zwei Reihen langer, scharfer Zähne. Er wagte weder vor- noch rückwärts auszuweichen; denn bei der geringsten Bewegung schnappte der entsetzliche Hund nach seiner Kehle. Zugleich fing er an zu heulen und zu bellen, und alsobald erschien der Hausknecht und die Frau mit Lichtern.
„Wohin, was wollt Ihr?“ rief die Frau.
„Ich habe noch etwas in meinem Karren zu holen“, antwortete der Fuhrmann, am ganzen Leibe zitternd; denn als die Türe aufgegangen war, hatte er mehrere braune, verdächtige Gesichter, Männer mit Büchsen in der Hand, im Zimmer bemerkt.
„Das hättet Ihr alles auch vorher abmachen können“, sagte die Wirtin mürrisch. „Fassan, daher! Schließ die Hoftüre zu, Jakob, und leuchte dem Mann an seinen Karren.“ Der Hund zog seine greuliche Schnauze und seine Tatzen von der Schulter des Fuhrmanns zurück und lagerte sich wieder quer über die Treppe, der Hausknecht aber hatte das Hoftor zugeschlossen und leuchtete dem Fuhrmann. An ein Entkommen war nicht zu denken. Aber als er nachsann, was er denn eigentlich aus dem Karren holen sollte, fiel ihm ein Pfund Wachslichter ein, die er in die nächste Stadt überbringen sollte; „das Stümpfchen Licht oben kann kaum noch eine Viertelstunde dauern“, sagte er zu sich; „und Licht müssen wir dennoch haben!“ Er nahm also zwei Wachskerzen aus dem Wagen, verbarg sie in dem Ärmel und holte dann zum Schein seinen Mantel aus dem Karren, womit er sich, wie er dem Hausknecht sagte, heute Nacht bedecken wolle.
Glücklich kam er wieder auf dem Zimmer an. Er erzählte von dem großen Hund, der als Wache an der Treppe liege; von den Männern, die er flüchtig gesehen, von allen Anstalten, die man gemacht, um sich ihrer zu versichern, und schloss damit, dass er seufzend sagte: „Wir werden diese Nacht nicht überleben.“
„Das glaube ich nicht“, erwiderte der Student; „für so töricht kann ich diese Leute nicht halten, dass sie wegen des geringen Vorteils, den sie von uns hätten, vier Menschen ans Leben gehen sollten. Aber verteidigen dürfen wir uns nicht. Ich für meinen Teil werde wohl am meisten verlieren; mein Pferd ist schon in ihren Händen, es kostete mich fünfzig Dukaten noch vor vier Wochen; meine Börse, meine Kleider gebe ich willig hin; denn mein Leben ist mir am Ende doch lieber als alles dies.“
„Ihr habt gut reden“, erwiderte der Fuhrmann; „solche Sachen, wie Ihr sie verlieren könnt, ersetzt Ihr Euch leicht wieder; aber ich bin der Bote von Aschaffenburg und habe allerlei Güter auf meinem Karren, und im Stall zwei schöne Rosse, meinen einzigen Reichtum.“
„Ich kann unmöglich glauben, dass sie Euch ein Leides tun werden“, bemerkte der Goldschmidt; „einen Boten zu berauben, würde schon viel Geschrei und Lärmen ins Land machen. Aber dafür bin ich auch, was der Herr dort sagt; lieber will ich gleich alles hergeben, was ich habe, und mit einem Eid versprechen, nichts zu sagen, ja niemals zu klagen, als mich gegen Leute, die Büchsen und Pistolen haben, um meine geringe Habe wehren.“
Der Fuhrmann hatte während dieser Reden seine Wachskerzen hervor gezogen. Er klebte sie auf den Tisch und zündete sie an. „So lasst uns in Gottes Namen erwarten, was über uns kommen wird“, sprach er; „wir wollen uns wieder zusammen niedersetzen und durch Sprechen den Schlaf abhalten.“
„Das wollen wir“, antwortete der Student; „und weil vorhin die Reihe an mir stehen geblieben war, will ich euch etwas erzählen.“
Es folgt nun bei Hauff die Erzählung „Das kalte Herz“ (Ein Märchen) https://de.wikisource.org/wiki/Das_kalte_Herz/Erste_Abteilung
Quelle: https://de.wikisource.org/wiki/Die_Sage_vom_Hirschgulden, Text gemeinfrei. Illustrationen von Fritz Bergen (Künstler und Postkartenmaler, 1857–1941) gemeinfrei.
Der Text wurde von mir (W.A.) sachte an geltende Rechtschreibung angepasst.